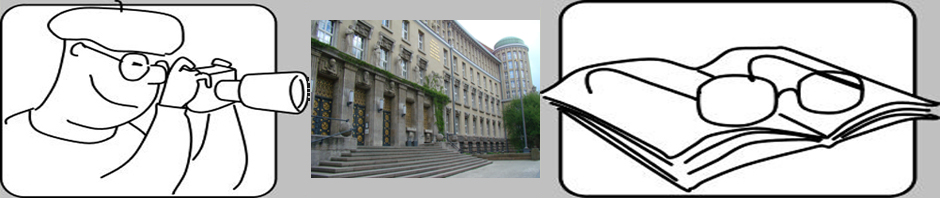Mindestens ebensogut kann ich mich an die Lese-Phase „Sagen“ erinnern, schon deshalb, weil sie Nachwirkungen bis heute hat. Erst kürzlich (d. i. 80er Jahre, d. A.) erstand ich zwei Bände klassischer griechischer Sagen, herausgegeben von Johannes Bobrowski. Mit den germanischen Heldensagen konnte ich nicht viel anfangen. Natürlich kannte ich die Siegfried-Sage, die Sagen um Dietrich von Bern und so weiter, und die sogenannten Heimatsagen waren mir zu hausbacken. Das bekannte Buch von Gustav Schwab dagegen ist für mich ein literarisches Schlüsselerlebnis gewesen. Später folgten andere, stärkere, aber es war wohl prägend für mein kindliches Gemüt. In der Bibliothek gab es damals eine besonders schöne dreibändige Ausgabe vom Kinderbuchverlag. Die Illustrationen waren klassischen Vorbildern nachempfunden, und bevor ich lesen konnte – mein älterer Bruder hatte sie sich ausgeliehen – machten sie mich neugierig auf diese Bücher. Ich bewunderte die Griechen, besonders Odysseus wegen seiner Cleverneß (Auch er muß ein „Leser“ gewesen sein, und daß er zunächst nicht an dem dubiosen Feldzug teilnehmen wollte, hätte mir zu denken geben müssen.), und ich verachtete die Trojaner. Paris hielt ich für ein Ausbund an Feigheit – man vergreift sich doch nicht an fremden Frauen! Ich war noch sehr jung, und bei Schwab konnte man nicht lesen, wo der Hund begraben liegt. Erst später, als ich in unserem „Theater der Jungen Welt“ das Stück „Die Trojaner“ sah, das wenig mit der griechischen Mythologie zu tun hatte, ging mir ein Licht auf …
Meine erste Klassenlehrerin war Frau Zimmermann. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, sie eine schöne Frau zu nennen, aber heute weiß ich, daß sie eine blasse, rotblonde Schönheit war mit einem zarten Körperbau und mit lustigen Sommersprossen im Gesicht, immer quicklebendig und voller Ideen, und wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich auch immer an Frau Zimmermann. Sie hat meine Liebe zu den Büchern immer gefördert, und sie war meine Klassenlehrerin bis zur dritten Klasse. Dann verlor ich sie ein wenig aus den Augen. Als ich in der sechsten oder siebenten Klasse war, leitete sie den Laienspielzirkel unserer Schule, dessen Mitglied ich wurde. Wir spielten Weihnachtsmärchen und politisches Kabarett, und wir „umrahmten“ Elternveranstaltungen. Meine Eltern waren stolz wie die Spanier, wenn ihr sonst so unauffälliger „mittelster“ Sohn sich auf der Bühne der Aula herumquälte, weil er wieder mal den Text nicht richtig gelernt hatte. Wir traten vor Schulkindern und Rentnern auf, zu Betriebsweihnachtsfeiern für die Kinder der Belegschaften irgendwelcher Betriebe, bei den sogenannten Volkswahlen und zu allen möglichen anderen Festlichkeiten. Manchmal wurden wir mit einem Bus ins Leipziger Umland kutschiert. Betriebsweihnachtsfeiern fand ich in Ordnung, weil dabei außer einem feuchten Händedruck auch immer Kakao und Stollen und ein Bunter Teller abfielen. Den größten Erfolg feierten wir mit dem Stück „Schneeweißchen und Rosenrot“ nach dem bekannten Märchen. Ich spielte den bösen Zwerg, und meine Partnerin Angelika Sander, die das Schneeweißchen spielte, mußte ständig meinen dreistufig konstruierten Bart aus Pelzresten kürzen. Einmal, es war auf der Kinderweihnachtsfeier einer LPG, fand sie die Sicherheitsnadeln nicht, mit denen er zusammengehalten wurde, oder sie konnte sie bloß nicht öffnen. Zur Sicherheit hatte sie immer eine Nagelschere dabei, aber bis sie die Schere gefunden und die Pelzreste zertrennt hatte, und das dauerte ein Weilchen, improvisierte ich wie der Teufel um die Zeit zu überbrücken. Mein lautes Geschimpfe, Gekreische und Gezeter brachte die Kinder im Saal zum Toben, und es gab Beifall auf offener Szene. Was für ein Erfolg! Frau Zimmermann kriegte sich vor Freude nach der Vorstellung gar nicht wieder ein. In der neunten und zehnten Klasse war sie wieder meine Lehrerin für Literatur, und meinen Aufsatz zur Abschlußprüfung habe ich im Stillen ihr gewidmet. Viele Jahre später, ich war bereits Vater meiner Kinder und meine Ehe lief schlecht, begegnete ich ihr in der Unterführung vor dem Leipziger Hauptbahnhof. Und noch ehe ich sie bemerkte, sprach sie mich an. Ich war schlechter Laune, irgendeine Besorgung war zu erledigen und ich hatte es eilig, und ich fühlte mich sowieso wegen meiner persönlichen Lage rundum unwohl. Sie strahlte über das ganze Gesicht, und in ihrer lebhaften Art wünschte sie Auskunft über meine Familie, mein Leben und meine berufliche Situation. Mir aber war die Begegnung eher lästig, und ich fertigte sie mit ein paar nichtssagenden Worten ab. Ich verabschiedete mich hastig, und dann rannte ich die Treppe zur Haltestelle der Straßenbahn hinauf. Auf der vorletzten Stufe stolperte ich. Ich konnte mich nicht abfangen, und ich stürzte. Ich knallte mit dem linken Schienbein gegen die Kante der obersten Stufe, und der Schmerz nahm mir den Atem und trieb mir Tränen in die Augen. Ich rappelte mich auf, und als ich mich umsah, sah ich Frau Zimmermann fassungslos und mit offenem Mund und mit aufgerissenen Augen am Fuße der Treppe stehen. Meine Straßenbahn kam, und unter Schmerzen lief ich los, um sie nicht zu verpassen.
(Forts. folgt)